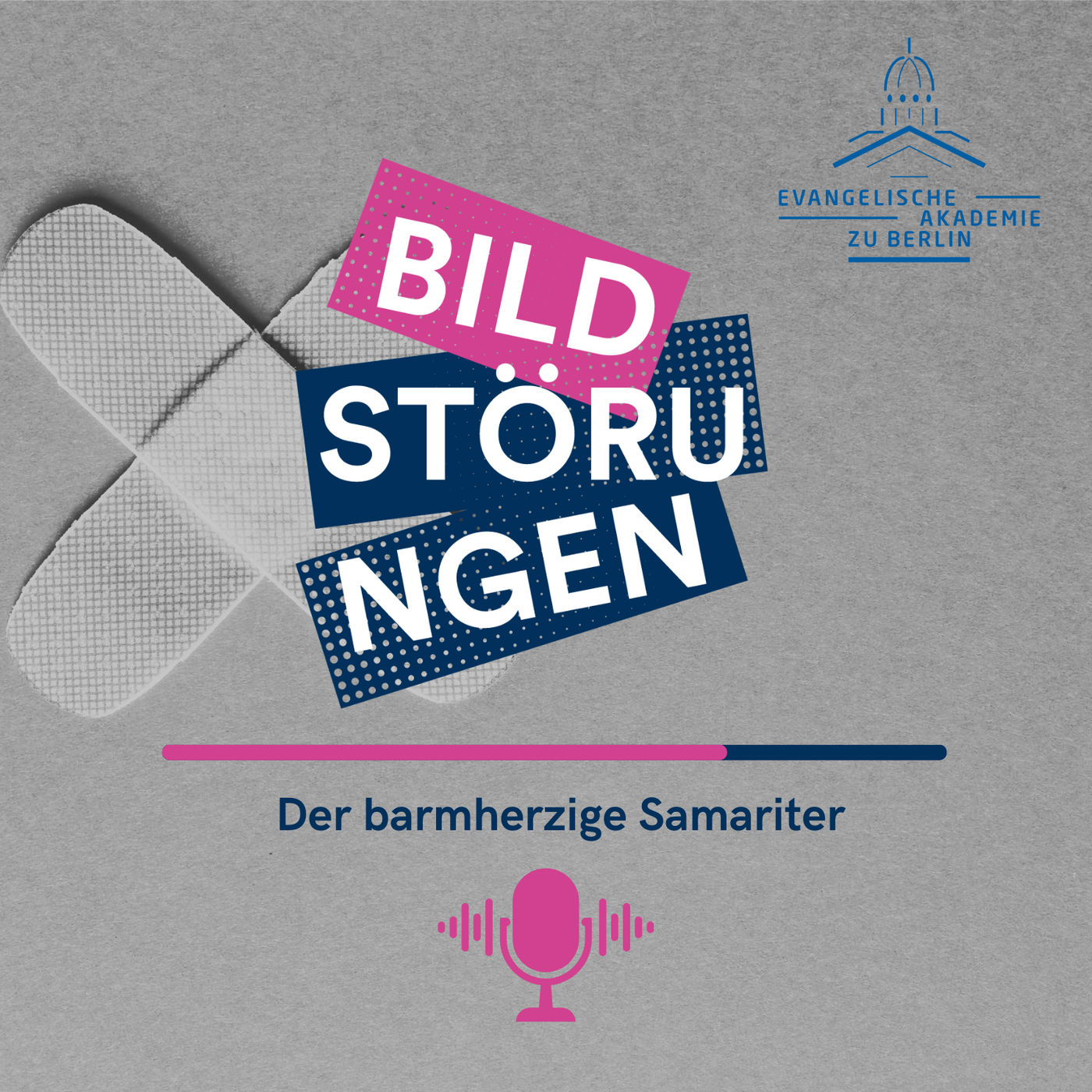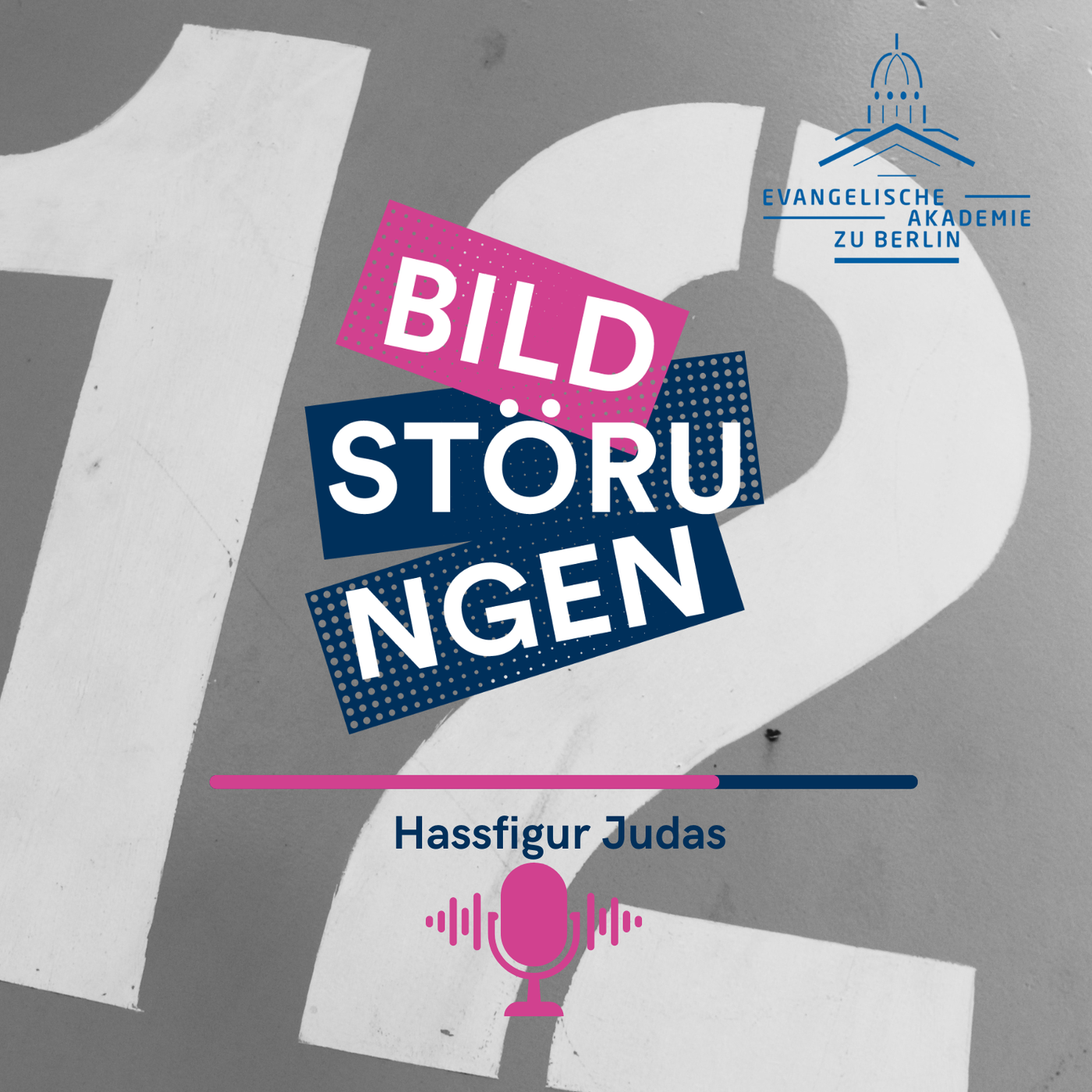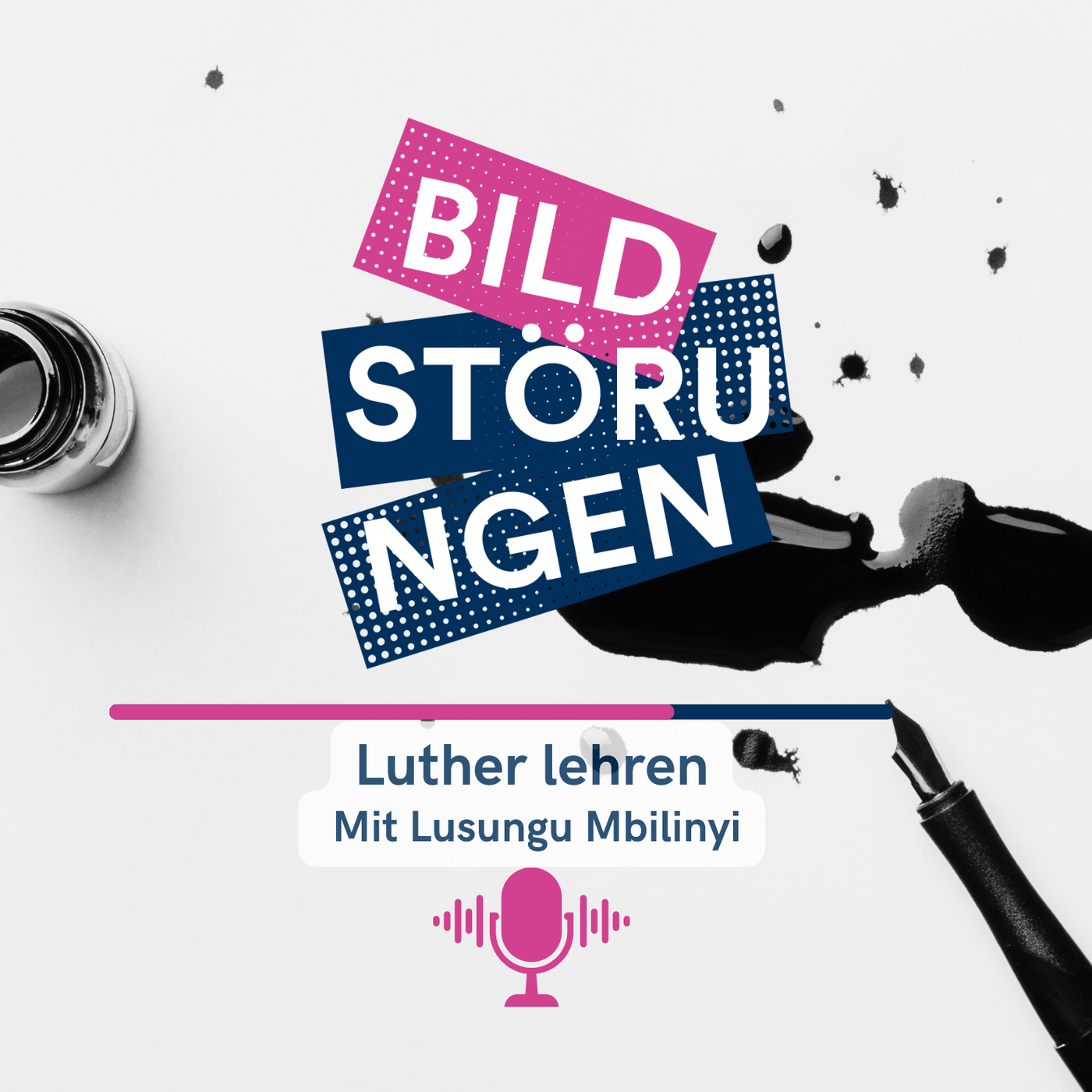
Luther lehren
In einer Sonderfolge zum Geburtstag Martin Luthers (10. November) sprechen wir mit dem tansanischen lutherischen Pfarrer Lusungu Mbilinyi über Anstößiges und bleibend Wichtiges in den Lehren Martin Luthers. In seinem Vikariat in Schmalkalden, einem der Brennpunkte der lutherischen Reformation im 16. Jahrhundert, stieß Mbilinyi auf die vehement antitürkischen und antisemitischen Schriften des Reformators. Inzwischen arbeitet er beim Lutherischen Weltbund in Genf. Im Gespräch erklärt Mbilinyi, warum er sich trotz der rassistischen, kolonialistischen, antisemitischen und sexistischen Aussagen Luthers auf dessen Theologie beruft.